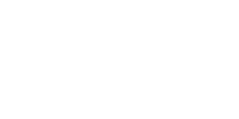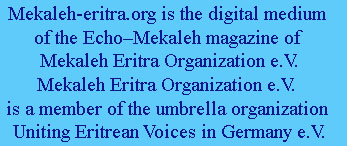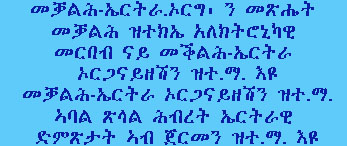Es gibt in Afrika vielleicht keinen anderen Ort, in den man sich sogleich verliebt und an dem die Einschüchterung doch so allgegenwärtig ist. Das diktatorisch regierte Eritrea mit seiner wundervollen Hauptstadt Asmara wirkt wie ein Gefangener seiner Vergangenheit.

Nach Eritrea reisen, um zu sehen, wie schlimm die Situation im Land wirklich ist. Was so einfach klingt, ist kompliziert. In einem anderen Land würde man beispielsweise mit Vertretern der Bürgergesellschaft sprechen, mit NGO, mit Repräsentanten verschiedener politischer Parteien, mit einheimischen Journalisten, mit dem IKRK, mit Gelegenheitsbekanntschaften. Das alles ist hier nicht möglich. Es gibt praktisch keine NGO, es gibt nur eine einzige Partei (die Regierungspartei), nur eine einzige Zeitung (die Regierungszeitung), das IKRK darf keine Gefangenen besuchen, und die Gelegenheitsbekanntschaften sind nicht scharf darauf, mit einem ausländischen Journalisten über die Regierung zu sprechen.
Wer bereit ist, über Politik zu reden, möchte auf keinen Fall namentlich erwähnt oder fotografiert werden. Selbst Minister scheuen vor klaren Aussagen zurück, und sogar die Gewerkschaft ist mehr oder weniger Teil des Regierungsapparats. Ein Diplomat sagt: «Im Ausland kommt man leichter an Informationen als in Eritrea selbst.»
Das hat damit zu tun, dass die Regierung mit Auskünften so sparsam umgeht, als befände man sich immer noch mitten im Krieg, aber auch damit, dass der Internetzugang sehr eingeschränkt ist. Wer einmal die Grenze zu Eritrea überschritten hat, ist praktisch von der Aussenwelt abgeschnitten. Es erstaunt nicht, dass die meisten Berichte über das isolierte Land, etwa von der Uno, sich vor allem auf Gespräche mit Exil-Eritreern abstützen. Ebenso wenig erstaunt es, dass die Regierung solche Experten-Reports vom Tisch wischen kann mit der Bemerkung: «Die waren ja nicht einmal hier.»
Überwachtes Flanieren in Asmara
Das alles kontrastiert mit der wunderbaren Atmosphäre der Hauptstadt Asmara, wahrscheinlich die schönste Stadt im subsaharischen Afrika. Breite, palmengesäumte Boulevards mit sauberen Gehsteigen laden zum Promenieren ein. Dass das Land in einer Zeitkapsel konserviert wurde, hat auch Vorteile. Nirgendwo sonst ist die italienische Art-déco- und Futurismo-Architektur erhalten wie hier. Man könnte Stunden in den Cafeterias, in den Kinos oder den Entrées der luftig-opulenten Hotels verbringen. Die Stadt liegt auf 2300 Metern über Meer, die Luft ist klar und frisch wie im Engadin. Viele Asmarinos bewegen sich per Velo fort, Autos gibt es wenige, oft sind es VW Käfer, Topolinos oder andere Wagen, die einen in die siebziger Jahre zurückversetzen. Aber man passt auf, nicht allzu sehr verführt zu werden.
Mitarbeiter internationaler Organisationen versichern einem, dass man permanent überwacht werde: «Du wirst nichts bemerken», heisst es. «Sie haben an den Strassenecken Spitzel postiert, die jeweils telefonisch durchgeben, wo du dich befindest und was du tust. Auch die Chauffeure rapportieren, wo sie dich hinbringen, und die Wächter vor dem Haus informieren, wer rein- und rausgeht. Telefon und E-Mails, sofern du es schaffst, eine zu schicken, werden überwacht. Wenn du in einem Restaurant mit jemandem ein Gespräch führst, und sei es auf Schweizerdeutsch, wird euch jemand belauschen, der die Sprache versteht.»
Ein Diplomat erzählt von einem Kollegen, der eine Nacht mit einer Eritreerin verbracht hatte. Am nächsten Tag klopfte ein Agent an ihre Türe und warnte sie davor, «mit Ausländern zu fraternisieren».
Die auf 2300 Metern über Meer gelegene Hauptstadt bietet viel italienische Art-déco- und Futurismo-Architektur.
Die schöne, friedliche Fassade in Asmara täuscht: Hinter ihr liegt einer der repressivsten Staaten Afrikas.
Die allgegenwärtige Überwachung kann man weder beweisen noch widerlegen. Das gilt auch für die unterirdischen Gefängnisse und die Frage, was mit Leuten passiert, die aus dem unbefristeten Nationaldienst fliehen und später zurückkehren. Die einzige Zeitung des Landes, «Eritrea Profile», ist ein Witz. Die Ausgabe vom 16. Oktober umfasst fünf Seiten. Eine ist dem Thema «Amphoren» gewidmet, eine den touristischen Sehenswürdigkeiten in der Gash-Barka-Region, eine dem Thema Lesen und eine einem jungen Sänger aus Asmara. Die Frontseite besteht aus nichtssagenden Regierungsverlautbarungen. Was den Tourismus betrifft, so dürfte er sich kaum so bald entwickeln. Das liegt nur schon daran, dass man für jeden Ort ausserhalb der Hauptstadt eine offizielle Reiseerlaubnis braucht.
Wahlen? Vielleicht in ein paar Jahrzehnten
Die repressiven Verhältnisse und der unbefristete Nationaldienst wurden gemeinhin mit dem angespannten Verhältnis zum grossen Nachbarn Äthiopien begründet. Im April letzten Jahres schlossen die beiden Staaten Frieden. Geändert hat sich trotzdem nichts. Abgesehen davon: Warum muss ein militärisch bedrohter Staat seine Bürger unterdrücken? In Israel, mit dem sich Eritrea gerne vergleicht, gibt es schliesslich auch Meinungsfreiheit und Wahlen. Vor wenigen Jahren wurde der inzwischen 73-jährige Isayas Afewerki, der seit der Unabhängigkeit Eritreas im Jahr 1993 Präsident ist, in einem Interview gefragt, wann er denn Wahlen durchzuführen gedenke. «Was für Wahlen?», fragte er verdutzt, um dann hinzuzufügen: «Vielleicht in drei, vier Jahrzehnten, oder mehr.» Man hat den Eindruck, er lebe auf einem anderen Planeten.
Eine Verfassung wurde schon 1997 geschrieben; sie trat aber nie in Kraft. Afewerki spricht gerne von «self-reliance», nationaler Selbstversorgung. Die meisten Eritreer sind Kleinbauern; sonst produziert das Land nicht viel. Und da es bis vor kurzem, wegen der angeblichen, unbewiesenen Unterstützung der Shabab-Jihadisten in Somalia, von internationalen Sanktionen belegt war, herrscht allerorten Mangel. Die Menschen verdienen wenig. Ein Minister kommt auf 200 Franken pro Monat. Ohne die Überweisungen ihrer Verwandten im Ausland könnten viele Familien nicht überleben. Seit langem ist eine Deindustrialisierung im Gang. Entgegen der sozialistisch geprägten Propaganda sieht man in den Strassen von Asmara zahlreiche Bettler. Im Oktober gab es nicht einmal einheimisches Trinkwasser im Land. Die vorher allgegenwärtigen Plastikflaschen waren vom Markt verschwunden. Stattdessen musste Wasser aus dem Sudan importiert werden, das seltsamerweise billiger war als das einheimische. Die Gründe für das Debakel kommunizierte die Regierung nicht. Die Leute sprachen von Korruption und illegalen Aktivitäten, aber es waren nur vage, widersprüchliche Gerüchte.
Eritrea zählt heute etwa 3,5 Millionen Einwohner. Es heisst, ein Fünftel der ursprünglichen Bevölkerung lebe im Ausland, allein in der Schweiz sind es etwa 40 000. Warum dieser Exodus? Yemane Gebremeskel, der Informationsminister, sagt im Gespräch, es seien vor allem die Pull-Faktoren. Die jungen Eritreer würden verführt von einem Eldorado-Europa, das einerseits eine Illusion sei, andererseits aber auch Realität. Tatsächlich bekämen sie Asyl, eine Wohnung, Taschengeld, ohne einen Finger krümmen zu müssen. «Das spricht sich natürlich herum, und jeder, der es geschafft hat, zieht zehn Weitere nach, die ihrer Familie zu Hause das Blaue vom Himmel vorschwärmen, aber nichts von den negativen Seiten erzählen. Und natürlich schildern die Migranten das Elend in Eritrea so krass wie möglich, damit sie Asyl bekommen.» Das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber es ist doch seltsam, wenn so gar nichts über die Push-Faktoren gesagt wird.
Umso seltsamer wird es, wenn man dieselben Standardsätze wieder und wieder hört. Tekeste Baire, der Generalsekretär der Nationalen Gewerkschaft, sagt beispielsweise genau dasselbe. Aber würden die jungen Eritreer wirklich für eine Flucht nach Europa ihr Leben riskieren, wenn in ihrer Heimat alles so wunderbar wäre? «Die Eritreer sind Kämpfer», antwortet Tekeste. «Sie geben nie auf. Haben sie sich einmal auf den Weg gemacht, sterben sie eher in der Wüste, als umzukehren.» Vielleicht haben sie gute Gründe, nicht umzukehren? «Selbst wenn sie aus dem Nationaldienst desertiert sind», sagt Tekeste, «passiert ihnen nichts, wenn sie zurückkehren. Sie müssen lediglich den Rest ihres Dienstes absolvieren.» Immerhin sagt er nach einiger Zeit doch, dass sie auch aus wirtschaftlichen Gründen emigrieren. «Es ist schwierig, einen Job zu finden.» Nach ein paar Tagen in Eritrea empfindet man schon ein solches Eingeständnis eines Offiziellen als wohltuende Offenheit.
Es gibt auch andere Gesprächspartner, die anfangs das Regime durch alle Böden verteidigen. Nach ein paar Tagen, wenn man sich etwas kennt, räumt einer dann ein, dass es sich um eine Diktatur handelt, ist aber der Meinung, es handle sich um die unvermeidliche und notwendige Abschottung eines jungen, schwachen Staates. Aber Selbstversorgung und Isolierung haben bisher noch nirgends funktioniert. Das musste auch Tansania schmerzlich erfahren, das diesen Weg in den siebziger Jahren ausprobierte. Andere Eritreer behaupten im Gespräch, man dürfe Eritrea nicht an Europa messen; die Verhältnisse in den restlichen Ländern auf dem Kontinent seien nicht viel besser. Aber selbst nach afrikanischen Massstäben gehört Eritrea zu den repressivsten Ländern.
Heroischer Unabhängigkeitskampf
Radikalere Staatsvertreter sprechen unverhohlen von Verrätern, wenn es um die Migranten geht. «Entweder man verteidigt sein Land, oder man geht und überlässt es den Äthiopiern», sagt einer. «Sie ziehen die Sicherheit in Europa dem Leben in Freiheit vor.» Aber vielleicht ist es auch umgekehrt: Sie haben genug vom Leben in Eritrea, wo sie zwar eine gewisse Sicherheit geniessen, aber wie Kinder gegängelt werden. Und sie riskieren für den Weg in die Freiheit ihr Leben.
In keiner eritreischen Grundsatzdiskussion darf der Verweis auf den heroischen Kampf für die Unabhängigkeit von Äthiopien fehlen. Auch Präsident Afewerki bezieht seine Legitimität vor allem aus seiner Rolle als Guerilla-Führer. Man fragt sich, ob er dem Schützengraben innerlich je entstiegen ist und ob er einem richtigen Tauwetter überhaupt gewachsen wäre. Im Gespräch erzählt jemand, der einmal neben Afewerki im Flugzeug sass, dass er die ganze Zeit in ein Buch vertieft gewesen sei. Er fragte ihn, wie er sich stundenlang dermassen konzentrieren könne. Afewerki antwortete nicht etwa, die Lektüre habe ihn fasziniert oder Spass gemacht, sondern: «Es ist eine Frage der Disziplin.»
Bevor Informationsminister Gebremeskel auf eine Frage antwortet, holt er jedes Mal zu einem langen historischen Rückblick aus. Die Vergangenheit scheint die Zukunft zu erdrücken. Das zeigt sich auch daran, wie viele Schlüsselstellen von alten Männern besetzt sind, deren Verdienste um die Unabhängigkeit grösser sind als die Kompetenz für die Position, die sie innehaben.
Aber wahrscheinlich kann man das Land nur verstehen, wenn man berücksichtigt, wie sehr die lange Geschichte von Missbrauch und Verrat die Volksseele verletzt hat. «Wir können niemandem trauen, und nur unser eigener Wehrwille kann uns retten», scheint das Fazit zu sein.

Der «Panzerfriedhof» in Asmara. In Eritrea scheint es oft so, als würde die Vergangenheit die Zukunft erdrücken.
Ein Wohnhaus in Asmara. Rund ein Fünftel der ursprünglichen Bevölkerung Eritreas lebt im Ausland.
1890 fiel Eritrea an die Italiener. Die Kolonialisierung dauerte bis 1941, als die Briten Mussolinis Truppen besiegten. Es gibt eine Anekdote aus dieser Zeit, die die Quintessenz der eritreischen Kollektiverfahrung ausdrückt. Eine Eritreerin jubelte den siegreichen Briten zu, bis ein Soldat ihr sagte: «Ich hab’s nicht für dich getan.» Eritrea war ein Spielball der internationalen Mächte, die das kleine Land für ihre Zwecke benützten. Die Bewohner zählten nichts. Die Briten verkauften die ganze Infrastruktur, die die Italiener hinterlassen hatten, dann übergaben sie an die Uno. Diese entschied, dass Eritrea mit Äthiopien eine Föderation eingehen solle. Es kam nicht gut. 1962 annektierte der äthiopische Kaiser Haile Selassie Eritrea. Die Uno schaute tatenlos zu, trotz anderslautenden Versprechen. Die USA hatten inzwischen mit Haile Selassie einen 25-Jahres-Vertrag abgeschlossen für die Einrichtung eines der weltweit wichtigsten Abhörzentren in Eritrea, genannt «Kagnew Station». Sie wollten keinen Ärger mit dem Kaiser. Der bewaffnete Unabhängigkeitskampf der Eritreer formierte sich. 1974 stürzte das kommunistische Derg-Regime den äthiopischen Regenten und startete seinen roten Terror. Die eritreischen Kämpfer rückten rasch vor, bis die Sowjetunion dem Derg-Führer Mengistu zu Hilfe eilte und sich die Eritreer in die menschenleeren Berge im Norden des Landes zurückziehen mussten. Hier harrten sie unter widrigsten Umständen aus, in einer Art Reduit.
Dies sind die heroischen Jahre des Widerstands, die zum Kern des eritreischen Selbstverständnisses geworden sind. Es kam zu einer jahrzehntelangen militärischen Pattsituation, bis den Eritreern 1988 in Afebet ein legendärer Sieg über die zahlenmässig massiv überlegenen Äthiopier gelang, der das Blatt wendete. Zu Hilfe kam ihnen, dass auch in Moskau unter Gorbatschow der Wille schwand, blutrünstige Herrscher wie Mengistu zu unterstützen, nur weil sie sich ein sozialistisches Mäntelchen umhängten; und dass sich auch in Äthiopien eine Rebellion gegen den Derg formierte hatte. 1991 marschierten eritreische und äthiopische Truppen gemeinsam in Addis Abeba und Asmara ein. In Addis Abeba übernahm Meles Zenawi das Ruder, in Asmara Isayas Afewerki. 1993 stimmten die Eritreer mit überwältigender Mehrheit für ihre Unabhängigkeit. Damit ging der Krieg zu Ende, der als längster des Kontinents gilt – gewissermassen der Dreissigjährige Krieg im Afrika des 20. Jahrhunderts. Er forderte gegen 200 000 Tote, die einerseits der Waffengewalt, andererseits dem mit dem Krieg einhergehenden Hunger zum Opfer gefallen waren.
Vom Frieden ist bis jetzt nichts zu spüren
 Aber schon 1998 überwarfen sich die ehemaligen Waffenbrüder, es kam zu einem zweijährigen Krieg um das Grenzstädtchen Badme, der 80 000 Tote forderte. 2002 sprach ein internationales Schiedsgericht Badme Eritrea zu, aber Äthiopien akzeptierte den Entscheid nicht. Eine Periode des kalten Krieges begann. Afewerki benützte die Bedrohung durch Äthiopien, um den Nationaldienst, der bisher 18 Monate betragen hatte, für unbefristet zu erklären, schaltete die freie Presse aus und liess Regimekritiker verhaften. Das Land schottete sich ab, aber der Exodus der Jungen liess sich nicht aufhalten. 2018 akzeptierte der neue äthiopische Staatschef Abiy Ahmed den Entscheid von 2002 und schloss Frieden mit Eritrea, wofür er kürzlich den Friedensnobelpreis erhielt. Im Gespräch erklärte der Informationsminister Gebremeskel, der Nationaldienst werde wieder auf die ursprünglichen 18 Monate zurückgestuft; solche Ankündigungen wurden jedoch schon früher gemacht. Von einer Lockerung der Repression ist bis jetzt auch sonst nichts zu spüren.
Aber schon 1998 überwarfen sich die ehemaligen Waffenbrüder, es kam zu einem zweijährigen Krieg um das Grenzstädtchen Badme, der 80 000 Tote forderte. 2002 sprach ein internationales Schiedsgericht Badme Eritrea zu, aber Äthiopien akzeptierte den Entscheid nicht. Eine Periode des kalten Krieges begann. Afewerki benützte die Bedrohung durch Äthiopien, um den Nationaldienst, der bisher 18 Monate betragen hatte, für unbefristet zu erklären, schaltete die freie Presse aus und liess Regimekritiker verhaften. Das Land schottete sich ab, aber der Exodus der Jungen liess sich nicht aufhalten. 2018 akzeptierte der neue äthiopische Staatschef Abiy Ahmed den Entscheid von 2002 und schloss Frieden mit Eritrea, wofür er kürzlich den Friedensnobelpreis erhielt. Im Gespräch erklärte der Informationsminister Gebremeskel, der Nationaldienst werde wieder auf die ursprünglichen 18 Monate zurückgestuft; solche Ankündigungen wurden jedoch schon früher gemacht. Von einer Lockerung der Repression ist bis jetzt auch sonst nichts zu spüren.
Es stimmt, dass nicht alles schlecht ist in Eritrea. Die HIV-Rate sowie die Mütter- und Säuglingssterblichkeit sind tief. Trotz den leeren Staatskassen gibt es eine kostenlose Gesundheitsgrundversorgung. Der Zugang zu Bildung ist besser als in vielen afrikanischen Ländern. Die Korruption dürfte eher tief sein, die Minister und der Präsident kommen ohne den Prunk und die Wichtigtuerei anderer Regenten auf dem Kontinent aus. Konflikte zwischen Ethnien und zwischen den Religionen existieren kaum. Und es gibt wohl kein anderes afrikanisches Land, in dem sich jemand entschuldigt, wenn er zehn Minuten zu spät kommt.
Aber Risse gibt es auch in Eritrea. Sowohl unter Muslimen wie unter Christen ist eine Radikalisierung zu beobachten. Die «kostenlose Gesundheitsversorgung» ist relativ. Viele Spitalärzte arbeiten nachts für ihre Privatpatienten. Der Service ist dann besser, aber er kostet. Und der Zugang zu Medikamenten ist oft schwierig und teuer. Der medizinische Service ist zwar, vor allem in der Hauptstadt, relativ gut, aber basal. Wie ein Eritreer sagt: «Impfen, Gebären oder Wundversorgung – kein Problem. Krebs, Herzinfarkt oder eine Operation – besser nicht in Eritrea, falls du überleben willst.» Ein anderer, der einmal in Burundi gewohnt hat, das auch nicht gerade für seine Spitzenmedizin berühmt ist, findet, dass die Versorgung dort besser sei. Dasselbe gilt für die Bildung. Die Schule ist autoritär und hierarchisch, eigenständiges Denken ist, wie vielerorts in Afrika, nicht gefragt. Und wie eine höhere Bildung ohne Internetzugang funktionieren soll, ist schleierhaft.
 Über den Nationaldienst ist es schwierig, genaue Angaben zu erhalten. Unbefristet ist er immer noch, auch wenn sich unter seinem Schirm alle möglichen Tätigkeiten und Arrangements versammeln. Aber eines ist klar: Auch wenn er nicht gleichzusetzen ist mit permanenter Sklaverei, so ist er doch ein staatliches Kontrollinstrument, das die Freiheit der Menschen extrem einschränkt. Es leuchtet ein, wenn der Informationsminister sagt, dass man all die Bürger im Nationaldienst nicht von einem Tag auf den andern entlassen kann, ohne ihnen Alternativen zu bieten. Ebenso leuchtet es ein, dass man die Grenzen nicht von heute auf morgen öffnen kann, ohne Einfuhr- und Zollbestimmungen zu erlassen. Es ist auch unzweifelhaft, dass im Laufe von Eritreas dramatischer Geschichte fremde Mächte seine Entwicklung immer wieder torpediert haben. Aber es gibt bei der Regierung eine Tendenz, immer nur die andern für alles Schlechte verantwortlich zu machen. Man kann es drehen und wenden, wie man will: Wenn ein grosser Teil der Jugend weggeht oder wegwill, muss etwas faul sein im Staat.
Über den Nationaldienst ist es schwierig, genaue Angaben zu erhalten. Unbefristet ist er immer noch, auch wenn sich unter seinem Schirm alle möglichen Tätigkeiten und Arrangements versammeln. Aber eines ist klar: Auch wenn er nicht gleichzusetzen ist mit permanenter Sklaverei, so ist er doch ein staatliches Kontrollinstrument, das die Freiheit der Menschen extrem einschränkt. Es leuchtet ein, wenn der Informationsminister sagt, dass man all die Bürger im Nationaldienst nicht von einem Tag auf den andern entlassen kann, ohne ihnen Alternativen zu bieten. Ebenso leuchtet es ein, dass man die Grenzen nicht von heute auf morgen öffnen kann, ohne Einfuhr- und Zollbestimmungen zu erlassen. Es ist auch unzweifelhaft, dass im Laufe von Eritreas dramatischer Geschichte fremde Mächte seine Entwicklung immer wieder torpediert haben. Aber es gibt bei der Regierung eine Tendenz, immer nur die andern für alles Schlechte verantwortlich zu machen. Man kann es drehen und wenden, wie man will: Wenn ein grosser Teil der Jugend weggeht oder wegwill, muss etwas faul sein im Staat.